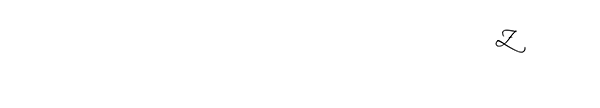Das Gasthaus & Team
und seine wunderschöne Umgebung
das team
Das Herzstück unseres Gasthauses
Lernen Sie unser Herzstück im Gasthaus zum Zabelstein kennen – unser engagiertes Team, das Tradition und Innovation leidenschaftlich vereint:
Gemeinsam als Familie führen wir das Gasthaus zum Zabelstein mit Hingabe und dem steten Ziel, Ihnen nicht nur Speisen, sondern einzigartige kulinarische Erlebnisse zu bieten. Unser Team steht für eine Küche, die Herz und Seele berührt – kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unserer Leidenschaft für erstklassige Gastlichkeit begeistern.

Timo Lenhard – Der Gastgeber
Seit 2011 prägt Timo Lenhard als Servicechef das Gesicht unseres Services. Ausgebildet in der feinen Kunst des Restaurantfachs, legt er größten Wert auf Höflichkeit, Aufmerksamkeit und einen schnellen, qualitativ hochwertigen Service. Timo ist das Bindeglied zwischen Küche und Gästen, stets darauf bedacht, jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis zu machen.
Isolde Lenhard – Unsere Visionärin
Als Gründerin und Geschäftsführerin bringt Isolde Lenhard über drei Jahrzehnte Erfahrung aus der Lebensmittelbranche mit. Getrieben von der Vision, eine eigene Gaststätte im malerischen Steigerwald zu eröffnen, verwirklichte sie diesen Traum gemeinsam mit ihren Söhnen. Ihr Engagement und ihre Liebe zur Gastronomie sind die Grundpfeiler unseres Hauses.
Dominik Lenhard – Der Kreative Kopf
Unser Küchenchef Dominik Lenhard vereint Tradition mit moderner Kulinarik. Seine Berufserfahrung und sein kreativer Ideenreichtum sind die Quelle unserer vielfältigen und innovativen Speisekarte. Ob traditionelle, saisonale, vegane oder vegetarische Gerichte – Dominik setzt auf Frische, Qualität und moderne Akzente, die jede Mahlzeit zu einem unvergesslichen Genuss machen.
Attratkionen aus der Umgebung
Erleben Sie den Zauber des Zabelsteins

Der Zabelstein Historischer Charme
Tauchen Sie ein in die Geschichte an der berühmten Burgruine Zabelstein, mit dem bekannten Aussichtsturm einem malerischen Zeugnis vergangener Zeiten, das zum Erkunden einlädt.

E-Bike-Ladestation: Für moderne Entdecker
Nutzen Sie unsere E-Bike-Ladestationen als Ausgangspunkt für Ihre Abenteuer im Steigerwald – ideal für umweltfreundliche Erkundungstouren.

Spielplatz: Spaß für die Kleinen
Der moderne und sicherer Spielplatz gegenüber bietet den perfekten Rahmen für unbeschwerte Stunden, während Sie sich entspannen und die Kulinarik genießen.

Wandern im Steigerwald: Natur pur
Erleben Sie die Schönheit des Steigerwaldes auf malerischen Wanderwegen, die durch atemberaubende Landschaften führen und Naturliebhaber begeistern.

Waldspielplatz mit See
Aus nachhaltigem Holz gefertigt, bietet er spannende Kletterstrukturen, Rutschen und Schaukeln, die zum Toben und Entdecken einladen – ein Ort, wo Spaß und Natur Hand in Hand gehen

Weinreben und Aussichten


Tradition und Natürlichkeit
Einzgartiger Flair. Drinnen und Draußen.
In den Mauern unseres traditionsreichen Gasthauses erwartet Sie eine Fusion aus Vergangenheit und Gegenwart.
Im Innenraum, liebevoll nach altfränkischer Manier gestaltet, begrüßen wir Sie mit 69 gemütlichen Sitzplätzen. Hier, unter kunstvollen Holzbalken und warmem Licht, spüren Sie das Herzstück fränkischer Gastlichkeit.
Jeder Winkel erzählt Geschichten von Generationen, die hier gelacht, gefeiert und genossen haben.
Doch das Erlebnis beschränkt sich nicht nur auf unsere historischen Wände. Treten Sie hinaus in unseren schattigen Biergarten, ein Refugium der Ruhe und Natur. Umgeben von blühenden Pflanzen und dem leisen Summen der Bienen, genießen Sie unsere kulinarischen Kreationen in idyllischem Ambiente.
Hier verschmelzen fränkische Köstlichkeiten mit dem Duft frischer Blumen und der Brise des Steigerwaldes.
Seien Sie unser Gast – wo Tradition auf Natur trifft und jeder Moment zählt.
Öffnungszeiten
MI – SA
15:00 - 21:00 Uhr
Warme Küche bis 19:45 Uhr
Reservierungen bis 19:15 Uhr
SO
11:00 - 16:00 Uhr
Warme Küche bis 15:00 Uhr
Reservierungen bis 14:30 Uhr
MO -DI
Ruhetage
Das erste Wochenende im Monat (Samstag & Sonntag) haben wir geschlossen.
Schreiben Sie uns
Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Fragen haben!
Folgen Sie uns auch gerne auf Social Media:
Gasthaus zum Zabelstein
Familie Lenhard
Falkenbergstraße 12
97513 Altmannsdorf
Tel. / Whatsapp: 09528-227
Datenschutz
Impressum